
Die Hoffnung auf gerechtere Welten
Trotz eher düsterer Zukunftsaussichten: Utopien bieten auch heute Anregungen für ein besseres Leben
Wer mag heute noch von Utopien sprechen? Angesichts zahlreicher Krisen und Kriege steht es nicht gut um die Entwürfe für eine bessere Zukunft. Wird der alte Slogan der globalisierungskritischen Bewegung „Eine andere Welt ist möglich“ also nur als Katastrophe wahr? Doch trotz verbreiteter Endzeitstimmung weist so manche gesellschaftliche und politische Entwicklung der letzten Jahre in eine andere Richtung. Und Utopien können weiterhin dazu motivieren, sich auf den Weg zu machen und für eine gerechtere und bessere Welt einzusetzen.
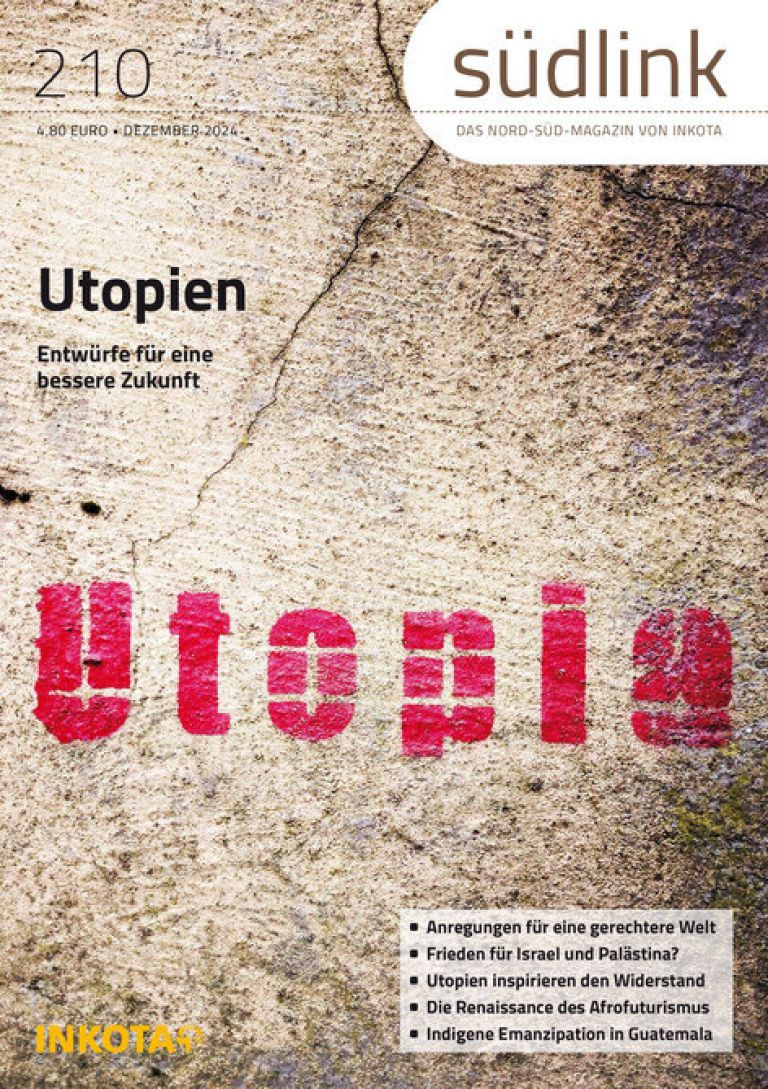
Was darf man noch hoffen? Jetzt, da sich der Autoritarismus durchsetzt, jedenfalls fürs Erste, und jedenfalls in großen Teilen der Welt? Wo Jugendrevolten im Globalen Süden gescheitert sind und starrsinnige alte Männer fast überall regieren? Wo Milliardäre über KI-gestützte Social-Media-Apparate herrschen und die globale Öffentlichkeit zunehmend zum Ozean der Filterblasen, voller Desinformation und Hetze verkommt? Und wo vom Klimaschutz kaum noch die Rede zu sein scheint? Utopisch scheint da die Hoffnung auf Rettendes, auf eine gute Zukunft.
Die Ideengeschichte hat klar umrissen, was eine ordentliche Utopie ausmacht: „Ein großer Gesellschaftsentwurf gehört dazu“, sagt der Utopie-Historiker Thomas Schölderle. Im Alltagsverständnis ist der Begriff weiter gefasst: als guter Ort, als befreite Gesellschaft, als Gleichheit, als gesicherte Bedürfnisbefriedigung, als Traum des Wünschenswerten, im Großen als Plan für die Menschheit und auch im Kleinen, als Insel oder Nische. Und natürlich als Dystopie, als Bild einer katastrophalen Zukunft.
Vielen klingt das Wort bis heute wie ein Versprechen, auch wenn die Utopie nach 1989 nachhaltig zu diskreditieren versucht wurde: Sie wurde für das Scheitern des Realsozialismus haftbar gemacht, als totalitär und gewaltbedürftig hingestellt. „Daran stimmte ganz wenig,“ sagt Schölderle. Doch von den Anwürfen erholte sich die Utopie nur schlecht.
Und auch wenn etwa die mexikanischen Zapatistas und in ihrer Folge die Globalisierungskritiker*innen um die Jahrtausendwende herum versicherten, dass eine „andere Welt möglich“ sei, sieht Schölderle wenig, das den Begriff im Sinne eines universalen Gesellschaftsentwurfs verdienen würde. Die letzte klassische Utopie sei schon 1975 erschienen, sagt er: „Ökotopia“, eine fiktive Reportage aus der Zukunft, in der der US-Autor Ernest Callenbach eine postmaterialistisch-technikfreundliche und nachhaltig-lebenswerte Welt des Jahres 1999 zeichnet
Abonnieren Sie den Südlink
Im Südlink können Autor*innen aus dem Globalen Süden ihre Perspektiven in aktuelle Debatten einbringen. Stärken Sie ihnen den Rücken mit Ihrem Abo: 4 Ausgaben für nur 18 Euro!
Keine gute Zeit für Utopien
In just jener Zeit, den später 1990er Jahren, mehrten sich die Stimmen, die die Utopien zu Grabe tragen wollten. Der Soziologe Armin Nassehi sprach vom „utopielosen“ anbrechenden 21. Jahrhundert. Er glaubte, dass es in funktional differenzierten Gesellschaften keine „zentrale Repräsentation“ mehr geben könne: Gesellschaften seien unwiederbringlich zersplittert, und wer sie im Dienste einer großen Idee wie dem Sozialismus wieder zusammenbringen wolle, werde notwendigerweise scheitern.
Andere verwiesen darauf, dass die Moderne das „Fortschrittsversprechen gebrochen“ habe, etwa durch die „Grenzen des Wachstums“. Und wo kein Fortschritt mehr möglich ist, da sei eben auch kein Platz mehr für Utopien, so hieß es oft – auch wenn Schölderle die Verbindung von klassischer Utopie und Fortschritt „künstlich“ und „nirgends nachgewiesen“ nennt.
Ohnehin ist die Rede vom Ende des Fortschritts kaum überzeugend. Auch wenn es vielen anders erscheint, ist menschlicher Fortschritt heute klar messbar: anteilig immer weniger extrem Arme und Hungernde, längeres Leben und bessere Gesundheit für viele, mehr Bildung, mehr Rechte. Dieser Fortschritt ist halbwegs stabil, noch jedenfalls, trotz der Polykrisen und der autoritären Wende. Er wird geringgeschätzt, obwohl er ein spektakulärer Erfolg sozialer Kämpfe und technischer Innovation ist. Und so ist nicht gesagt, dass die nächste Generation es nicht „besser haben“ kann.
Schon im 19. Jahrhundert kam die Utopie denn auch gleichsam als Prognose einer technokratischen Linearität daher. Der Übergang zur Science Fiction war fließend. Und die Technik als Instrument, um den Mensch von der Fron der Arbeit zu entlasten, ist ein altes utopisches Motiv. Nur folgerichtig war da etwa die sozialistische Heilserwartung an die frühen Computer, deren Rechenkraft die sich aus der Summe der Bedürfnisse ergebende „gesellschaftlich notwendige Arbeit“, ganz ohne den ungeliebten Markt, zu beziffern imstande sein würden. So sollte die Technologie der Utopie zur Umsetzung verhelfen.
INKOTA-Newsletter
Unsere Aktionen, Veranstaltungen, Projekte: Melden Sie sich jetzt für unseren E-Mail-Newsletter an.
Demokratische Planwirtschaft mit Künstlicher Intelligenz
Die taz-Redakteurin Malene Gürgen griff den Gedanken kürzlich mit Blick auf die heutigen Herausforderungen wieder auf. „Demokratische Planwirtschaft“, so schrieb sie, könne dabei helfen, besser mit den planetaren Ressourcen umzugehen, als wir es gerade tun. „Und KI könnte dabei helfen, diese Wirtschaftsweise so zu organisieren, dass sie auch funktioniert.“ Wichtig sei die Rolle der Konsumierenden: Haben sie ein Mitspracherecht was hergestellt wird? Allerdings: „Das Pariser Klimaabkommen hätte im Zweifel Priorität vor dem individuellen Wunsch nach einem neuen Auto.“ Das sei gewiss kompliziert, doch wenn nicht nur Angebot und Nachfrage darüber entscheiden, was hergestellt wird, dann brauche es eben mehr Planung. „Gut also, dass es inzwischen technische Instrumente gibt, die dieser Komplexität gewachsen sind.“
So undemokratisch wie sie bisher organisiert sind, wirken KI und die Sozialen Medien auf viele heute indes eher als Vorboten einer Dystopie. Ein Backlash zeichnet sich womöglich ab, in dem der Rückzug aus dem Digitalen als „guter Ort“ erscheint – ein entnetztes Leben als Utopie. Diese wäre eine Absage an den Fortschritt und vielleicht stünde es der Linken heute deshalb besser an, eine Utopie zu verfolgen, in der private Konzerne keine Macht über soziale Medien und das Netz anhäufen können – sondern unter demokratische Kontrolle gestellt werden, etwa nach dem Vorbild der freien Online-Enzyklopädie Wikipedia.
Mit Blick auf die Klimakrise haben sich die Rollen beim Umgang mit der Technik zwischen den Lagern heute teilweise umgekehrt: Linke drängen heute auf das Bewahren, unter anderem durch „Degrowth“ – eine unter kapitalistischen Prämissen durchaus utopische Idee vom Ende des Wachstums. Konservative hingegen setzen, anders als früher, auf den Glauben an utopische Technik. So will etwa CDU-Chef Friedrich Merz die Klimakrise mit noch gar nicht verfügbaren Technologien wie CO2-Abscheidung oder Fusionsenergie bekämpfen.
Auch der Transhumanismus als Sammlung utopischer Ideen hatte zuletzt eine gewisse Konjunktur. Der Mensch soll dabei über seine begrenzten Möglichkeiten hinauswachsen, durch Reisen in den Weltraum etwa, Verlängerung des Lebens oder medizinische Eingriffe wie Chip-Transplantationen. Diese Ideenwelt reicht lange zurück, bekam aber in der jüngeren Vergangenheit einen neoliberal-technokratischen Drall: als Selbstoptimierung
Diskreditiert wird der Transhumanismus heute nicht wegen seiner Affirmation des Leistungsdiktums. Vielmehr spießten ihn demokratiefeindliche Bewegungen als Bedrohung für traditionelle Werte und die menschliche Natur durch „globalistische Eliten“ auf. „Gender“ wird – über den Gedanken der „Gender-Fluidität“ – dabei mitgedacht und macht das Ganze anschlussfähig sowohl für rechtsextreme als auch für gewisse christlich-bürgerliche Kreise. Dahinter steckt die Prämisse einer natürlichen sozialen Lebensform, die gegen äußere Angriffe verteidigt werden muss. So positioniert sich der Autoritarismus heute einmal mehr als anti-utopisch.
In der Literatur taucht die Utopie vielfach als Insel auf, innerhalb eines unveränderten Ganzen. „Heterotopie“ nannte der französische Philosoph Michel Foucault wirkliche Orte mit „tatsächlich realisierten Utopien“. Sie funktionieren nach anderen Regeln als die Gesellschaft um sie herum. Groß war bei solchen Nischen oft die Angst, das mängelbehaftete Außen würde die utopischen Zustände stören. Frühsozialisten um Robert Owen etwa versuchten sich ab 1824 im US-Bundesstaat Indiana am Aufbau einer „New Harmony“ genannten Modellstadt mit kollektiven Produktionsmodellen. Die scheiterte aber innerhalb von nur drei Jahren, weil, so die Historie, auch Individuen hereingelassen wurden, die sich dem Konsens einer für alle richtigen verbindlichen Lebensweise versperrten.
Für eine gerechte Welt
Setzen Sie sich dauerhaft mit uns für eine gerechte Welt ohne Hunger und Armut ein und werden Sie INKOTA-Fördermitglied! Als Mitglied erhalten Sie zudem viermal im Jahr unser Magazin Südlink druckfrisch nach Hause.
Hier Fördermitglied werdenUtopie als gelebte Solidarität
Überlebt die Utopie also eher als exklusiver Ort? Mit dem Anspruch, den heute zumindest Linke an utopische Zustände stellen, sind abgeschottete Nischen kaum vereinbar. Können „Heterotopien“ trotzdem ein linkes Projekt sein? „No Border Lasts Forever“ hieß vor etwa zehn Jahren eine Serie von Konferenzen der antirassistischen Bewegung. Der Titel lässt sich auf zweierlei Weisen übersetzen: „Keine Grenze ist für immer“ und „No Border-Kämpfe gehen immer weiter“. Die dahinter stehende Utopie ist offenkundig: Eine Welt unbeschränkter Mobilität für alle, die so globale Umverteilung fördert.
Vielen scheint die Zeit heute mit Blick auf die Migrationspolitik eher dystopisch. Doch waren die Jahre ab 2014 auch eine Phase ungekannter Blüte praktischer Solidarität. Unter anderem abzulesen war das etwa an den „Welcome2Europe“-Guides des gleichnamigen Netzwerks: Broschüren mit allen Orten, an die sich „People on the Move“ für Hilfe wenden können. Sie wurden über die Jahre immer dicker. Denn wo die einen die „Festung Europa“ nur beklagten, erschufen andere einen wahren Kontinent der praktischen Solidarität im Kleinen. Trotz aller Widerstände wird darin jeden Tag Hunderttausenden geholfen anzukommen, zu bleiben, ihre Lebensperspektive zu finden. Ist das nicht eine „tatsächlich realisierte Utopie“?
Die Klimakrise, das ist sicher, wird mehr „People on the Move“ hervorbringen. Die Philosophin Eva von Redecker glaubt, dass die Vorbereitung auf das Kommende deshalb nur darin bestehen kann, das Teilen zu üben. Das Privileg des 21. Jahrhunderts werde sein, nicht fliehen zu müssen, sondern einen Ort zu haben, von dem man nicht wegmuss. „Es stellt sich dramatisch die Frage: Wie können wir auf anständige Weise diese Orte teilen, wie sie erhalten und für die Welt öffnen?“ Diese Frage verlangt zweifellos nach utopischer Energie. Zu den großen Versprechen zählt oft auch der Gedanke der Befreiung, etwa jener der Frauen oder der Befreiung von Herrschaft an sich. Beispiele dafür finden sich in den utopischen Schriften zuhauf. Der französische Schriftsteller Gabriel de Foigny etwa beschreibt in seinem Roman „La Terre australe connue“ 1676 eine Insel, deren Bewohner*innen in absoluter Rationalität, ohne gewalttätige Wünsche oder Leidenschaften leben. Es handelte sich um Hermaphroditen, die Aufhebung der Geschlechtertrennung macht hier die ideale, anarchistische Gesellschaft möglich. Die Menschen sind so vernünftig, dass sie auf jede staatliche Befehlsgewalt komplett verzichten können, Vernunft ersetzt die Herrschaft.
Gegen die Unvernunft der Gegenwart
Anarchistische Denktraditionen setzen darauf, dass der Staat sich abschafft, wie bei Gabriel de Foigny. Andere sehen im Staat ein Instrument zur Gesellschaftstransformation, hin zur „guten Ordnung“. Zu ihnen zählt etwa der mittelalterliche Dominikaner-Mönch und Philosoph Tommaso Campanella. Ihm schwebte eine Art europäische Zentralmonarchie vor, die imstande sei, neben der Hungersnot auch „Feindschaft, Ehrgeiz und Habsucht in der Welt aufhören“ zu lassen.
Ganz fremd ist die staatsbasierte Utopie der Linken heute nicht. Den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ hatte der venezolanische Präsident Hugo Chávez 2005 als Leitmotiv ausgerufen. Und nicht wenige Linke auf der Welt setzten in Chávez’ damals noch weitgehend unkorrumpierte „Bolivarische Revolution“ Hoffnung. Sie mussten aber in den Folgejahren zur Kenntnis nehmen, dass Venezuela spätestens unter der Führung von Chavez’ Nachfolger Nicolas Maduro und unter dem Druck der US-Sanktionen zum glatten Gegenteil wurde. Als Chávez an die Macht kam, hatte Venezuela gut 20 Millionen Einwohner*innen; seither flüchteten rund 7,7 Millionen Menschen aus dem Land – und das ohne Krieg.
Hoffnungsfroher stimmte Rojava, die der kurdischen Befreiungsbewegung PKK nahestehende Autonome Verwaltung von Nord- und Ostsyrien ab 2012. Inspiriert von den ökoanarchistischen Ideen des US-Linken Murray Bookchin setzten die Kurd*innen dort auf Basisdemokratie, Frauenrechte und Ökologie. Der geistige Vater des ganzen, PKK-Führer Abdullah Öcalan sprach von einem Projekt „jenseits von Staat, Macht und Gewalt“.

Für viele ein Ort mit utopischem Gehalt, ein Schritt auf dem Weg zu einem befreiten Kurdistan: die autonom verwaltete Region Rojava in Nord- und Ostsyrien
Mit dem Recht zum „Guten Ort“?
Doch kann auch das Recht heute ein Vehikel auf dem Weg zum „Eu-topos“, zum Guten Ort, sein? Der Humangeograf Carsten Felgentreff von der Universität Osnabrück erforscht seit Jahrzehnten die sozialen Folgen sogenannter Naturrisiken, also etwa Dürren, Brände, Überschwemmungen – all das, was der Klimawandel mit sich bringt. Für ihn liegt der Schlüssel zur Anpassung daran auf der Ebene des Rechts. „Wenn man Menschenrechte ernst nehmen würde, würden sich viele andere Debatten erübrigen“, sagt er. „In Staaten, in denen Politiker sich in freien Wahlen legitimieren lassen müssen und wo eine freie Presse offen über Unrecht berichtet, dort verhungern Menschen nicht massenhaft.“ Der Zusammenhang von politischer Freiheit und sozialer Entwicklung sei offensichtlich, und die beste Antwort auf die Klimakrise seien demnach „rechtebasierte Ansätze für alle.“ Denn die Härte, mit der bestimmte Krisen einzelne Menschen treffen, habe viel mit ihrer gesellschaftlichen Stellung zu tun. Diese zu verbessern sei künftig noch „wichtiger als Technologie“, sagt Felgentreff.
Angesichts des Drucks unter den Rechtsstaatlichkeit heute durch die autoritäre Dynamik gerät und der daraus folgenden Erosion hart erkämpfter Normen hat dies schon fast utopische Qualität. Ist das aber ein im Vergleich zu den großen Versprechen von einst nicht ein kümmerlicher Zukunftsentwurf – eine Welt, deren Qualität ist, Recht im bürgerlichen Staat durchsetzbar zu halten? Doch diese hätte immerhin den Vorteil, konkret und halbwegs verlässlich das Leben zu verbessern, statt sich, wie Utopien sonst oft gern, „im Irgendwann und Nirgendwo, im ‚outópos‘“einzurichten.
Negative Utopien sind als Dystopien bekannt, etwa Überwachungsgesellschaften wie George Orwell oder Aldous Huxley sie ersonnen haben. Für die Politikwissenschaftlerin Nadja Meisterhans steckt in der Dystopie ein „latentes Moment der Utopie“. Sie sei ein Weckruf, sie frage, was passiert, wenn die Macht- und Herrschaftsstrukturen nicht verändert werden. Die dystopische Erzählung könne das Unbehagen und manifeste Leiden „fantasievoll benennen“ und in der Kritik des Bestehenden zumindest implizit auf Veränderbarkeit zielen und diese so ermöglichen. Denn Utopien waren in der Vergangenheit nicht notwendigerweise als Bauplan für den „guten Ort“ gedacht, sondern eher als Spiegel, in dem Gesellschaften ihre eigenen Fehler erkennen und in die Lage versetzt werden, diese klüger beheben zu können.
Christian Jakob ist Redakteur der tageszeitung. 2023 erschien von ihm im Verlag Ch. Links „Endzeit. Die neue Angst vor dem Weltuntergang und der Kampf um unsere Zukunft“.
Titelbild: Lucas Theiss (CCO 1.0)
weiteres Foto: Julia Tulke (CC BY-NC-SA 2.0)



